Aktuelle Projekte und Kooperationen
Ziel des Projekts ist die Konzeption, Erprobung, evaluationsbasierte Weiterentwicklung und Verstetigung eines digital-gestützten Studienangebots zur Förderung der Educational Data Literacy von Lehramtsstudierenden. Das Studienangebot soll Lehramtsstudierenden Erfahrungsräume für eine kritische Auseinandersetzung mit Befunden aus dem Inhaltsbereich der Schul- und Unterrichtsforschung ermöglichen.
- Förderung: Lehrfonds LeNA
- Projektleitung: Prof. Dr. Robin Busse
- Projektkoordination: Irina Wilhelm.
- Laufzeit: 01.01.2025 – 31.12.2026
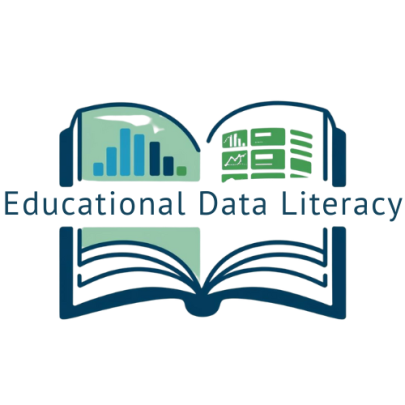
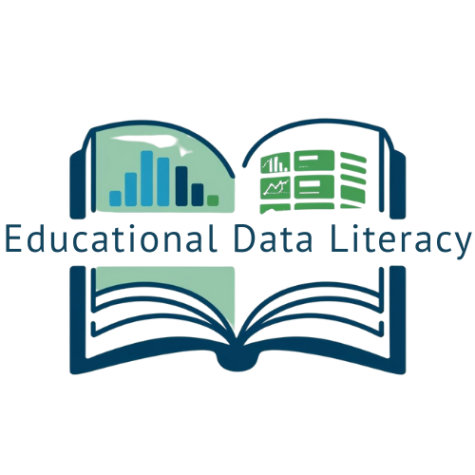
Bundeslandübergreifendes Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Weiterentwicklung der Qualität der Berufsorientierung an beruflichen Schulen.
- Förderung: BMBFSFJ
- Verbundleitung: Prof. Dr. Susan Seeber
- Eigene Funktion: Projektleitung
- Laufzeit: 01.10.2024–30.09.2027
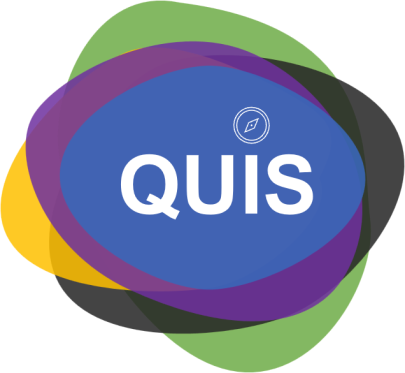
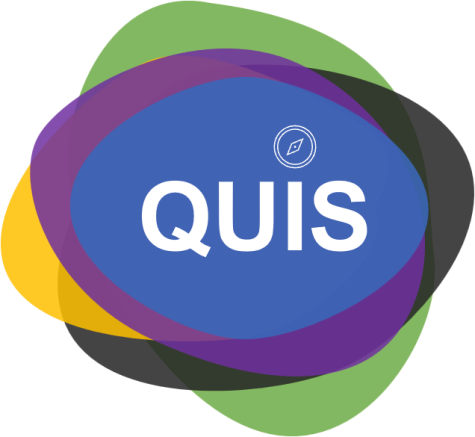
- Finanzierung der Studie: Prof. Dr. Susan Seeber (Eigenmittel)
- Laufzeit: 01.07.2024 – 31.12.2024
Bundesweite Umfrage zur Erfassung der demokratischen Praxis und Einstellungen von jungen Erwachsenen in Arbeit, Ausbildung und Studium sowie demokratischer Lerngelegenheiten am Arbeitsplatz und in den Lernorten Berufsschule, Betrieb und Hochschule. Hierzu wurden zwischen Juli – September 2024 im Rahmen eines Access Panels (Bilendi) bundesweit junge Erwachsenen im Alter von 18 bis 35 Jahren befragt (n = 3.000). Aktuell erfolgt die Auswertung und Veröffentlichung der Befunde.
Kollaboration im EU-Rahmenprojekt “Pioneering policies and practices tackling educational inequalities in Europe (PIONEERED)”
- Förderung der Kollaboration: Eigenmittel
- Gesamtkoordination PIONEERED: Prof. Dr. Andreas Hadjar (Universität Luxemburg)
- Leitung Deliverable 4-2: Dr. Andrea B. Erzinger, Dr. Simon Seiler, Robin Benz (Universität Bern)
- Eigene Funktion: Kollaboration (Mitarbeit an Beitrag von Deliverable 4-2, Working paper scientific: “Consequences of school segregation on achievement and attainment” im Rahmen des Working Package 4)
- Kollaborationspartner: Dr. David Glauser (Universität Bern), Prof. Dr. Katja Scharenberg (LMU)
- Laufzeit: 01.03.2021–29.02.2024
Die Bildungssysteme in Deutschland und in der Schweiz sind einerseits gekennzeichnet durch eine frühe Differenzierung in verschiedene Bildungsgänge mit unterschiedlichem Anforderungsniveau (tracking). Beide Länder verfügen zudem über ein hoch differenziertes Berufsbildungssystem, das Jugendlichen einen relativ nahtlosen Übergang in eine qualifizierte Beschäftigung ermöglicht. Andererseits werden in beiden Ländern regelmäßig ausgeprägte herkunftsbedingte Disparitäten im Bildungserfolg empirisch nachgewiesen. Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeiten beider Bildungssysteme kann ein Ländervergleich wertvolle Erkenntnisse dahingehend liefern, ob unterschiedliche schulische Lern- und Entwicklungsumwelten, die aufgrund der Segregation in der Sekundarstufe entstehen, in beiden Ländern ähnliche oder unterschiedliche Effekte auf nachobligatorische Bildungsverläufe im Anschluss an die Pflichtschulzeit entfalten.
Unser Forschungsvorhaben verfolgt zwei Ziele: Erstens werden herkunftsbedingte Unterschiede in den Bildungsübergängen und ethnische Segregation an verschiedenen Schnittstellen des Bildungssystems (von der Sekundarstufe I über die Sekundarstufe II bis zum Übergang in die Hochschule) untersucht. Zweitens werden theoretische Mechanismen herkunftsbedingter Disparitäten empirisch geprüft und ihr relativer Erklärungsbeitrag bestimmt.
Publikationen
- Glauser, D., Busse, R., & Scharenberg, K. (in press). Consequences of ethnic segregation on educational attainment at upper secondary level in Germany and Switzerland. Spotlight Article of PIONEERED Deliverable 4.2: Consequences of school segregation on achievement and attainment. PIONEERED is funded from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101004392.
Kooperation zur Evaluation eines Planspiels im Rahmen der Lehrveranstaltung “Unternehmen und Märkte" an der Georg-August-Universität Göttingen
- Finanzierung der Kooperation: Eigenmittel
- Kooperationspartner: Prof. Dr. Sebastian Hobert (Universität zu Lübeck) und Dr. Philipp Hartmann (Georg-August-Universität Göttingen)
- Laufzeit: 01.06.2022–29.06.2024
Kooperatives Lernen ist ein zentraler Bestandteil von Planspielen. Aus Sicht der kognitiv-konstruktivistischen Theorie bestehen Erklärungen, warum kooperatives Lernen das Lernen von Schüler:innen begünstigen kann: So erfordern kooperative Lernformen Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Ideen, Ansichten und Konzepten. Zudem fördert der gemeinsame Austausch die Weiterentwicklung kognitiver Strukturen. Unklar ist bislang, wie sich die Qualität des kooperativen Lernens und die Heterogenität kooperativer Lerngruppen auf die Wirksamkeit von Planspielen auswirkt.
Unser Forschungsvorhaben verfolgt zwei Ziele: Erstens werden Unterschiede im kooperativen Lernen im Rahmen des Planspiels untersucht. Zweitens werden Mechanismen des Einflusses des kooperativen Lernens auf die Wirksamkeit des Planspiels hinsichtlich zentraler Lernergebnisse bestimmt.
Wissenschaftliche Untersuchung der Demokratiebildung an berufsbildenden Schulen (Fokus: Berufsschulen) in Niedersachsen
- Finanzierung der Studie: Eigenmittel
- Laufzeit: 01.04.2022–29.06.2024
„Demokratie braucht engagierte Demokratinnen und Demokraten und muss von jeder Generation neu gelernt werden“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2019, S. 45). Um junge Menschen zu handlungsfähigen, mündigen Bürger*innen zu erziehen, die am gesellschaftlichen Leben der modernen Wirtschaft und Gesellschaft teilhaben, ist Demokratiebildung und Werteerziehung erforderlich (Feil, 2019, S. 3-7). Der beruflichen Ausbildung im Allgemeinen und dem Lernort der Berufsschule im Besonderen kommen in diesem Kontext eine zentrale Bedeutung zu. Zum einen liegt ein Schwerpunkt der normativen Zielstellung beruflicher Bildung auf der Förderung gesellschaftlicher Teilhabe (Baethge et al. 2003). Zum anderen hat die Berufsausbildung weitere wichtige Schlüsselfunktionen: Einerseits ist sie für eine große und äußerst heterogene Gruppe junger Erwachsener ein perspektivenreicher Bildungsweg für die Gestaltung der Berufslaufbahn und weiterführenden gesellschaftlichen Teilhabe, andererseits eröffnen die unterschiedlichen Lernorte und neuen Sozialisationskontexte in der Berufsausbildung verschiedene Möglichkeiten der Förderung demokratischer Kompetenzen. Zudem besteht der Bildungsauftrag der Berufsschule nicht nur darin, Auszubildende zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf zu befähigen, sondern auch auf die „Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung“ (KMK, 2011) vorzubereiten, denn „in der Arbeitswelt bedarf es politisch-demokratisch handlungsfähiger Beschäftigter“ (Zurstrassen 2020, S. 134). Der Berufsausbildung wird somit sowohl im Hinblick auf die politische Sozialisation als auch auf den Erwerb demokratischer Kompetenzen ein wichtiges, aber auch weitgehend unerforschtes Potenzial zugeschrieben (Besand, 2014; Zurstrassen, 2020). Die Bedeutung der Demokratiebildung an beruflichen Schulen wird darüber hinaus durch den neuen strategische Handlungsrahmen für berufsbildende Schulen unterstrichen (Niedersächsisches Kultusministerium 2021).
Vor diesem Hintergrund liegt das Ziel der wissenschaftlichen Untersuchung in der Untersuchung von Konzepten, Herausforderungen und Verankerungen der Demokratiebildung an Berufsschulen. Hierzu wurden im Rahmen einer Mixed-Methods-Studie das Schulpersonal berufsbildender Schulen in Niedersachsen (n = 56) befragt.







