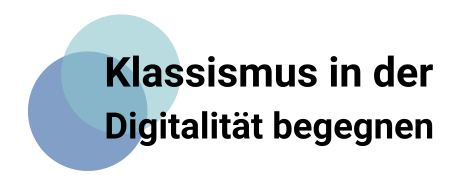Das aus zQSL-Mitteln (LeNA) finanzierte Projekt thematisiert Klassismus aus intersektionaler Perspektive als eine Form von Diskriminierung und Ausgrenzung im Bildungs- und Universitätswesen. Der besondere Fokus liegt neben inneruniversitären Reproduktionsmechanismen von sozialer Ungleichheit und Klassismus auf der Analyse von Klassismus und Ungleichheitsverhältnissen in der Digitalität.
Neben einem habitussensiblen und differenzreflexiven Lehrangebot in jedem Semester werden regelmäßige universitätsweit zugängliche Workshops & Fortbildungen zu sozialer Ungleichheit und Klassismus, eine Ringvorlesung zum Thema „Soziale Ungleichheit, Klasse und Digitalität“ im Wintersemester 25/26 sowie das studentisches Literaturprojekt „Herkunft erzählen“ durchgeführt.
Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt des Arbeitsbereichs „Pädagogik in der Digitalität“ und des Arbeitsbereichs „Praxislabor“.
Laufzeit: 01.01.2025 bis 31.12.2026
Angebot
Hier geht es zur Ringvorlesung „Soziale Ungleichheit, Klasse und Digitalität“
Die miteinander verschränkten Projektelemente wirken selbstermächtigend und unterstützen Studierende beim Ausbau studienrelevanter Kompetenzen. Im Studium auftretenden und nicht thematisierten Problemlagen bezüglich sozialer Herkunft wird ein Raum eröffnet und damit zur Herstellung von Chancengleichheit beigetragen.
Die Angebote sollen fachübergreifend auf vier Ebenen zur Stärkung von Bildungsgerechtigkeit beitragen:
Da das wissenschaftliche Schreiben First-Generation-Studierende vor besondere Herausforderungen stellen kann, möchten wir gerne auf das Kooperationsprojekt „Schreiben für bessere Chancen“ hinweisen. Ein Flyer findet sich unter folgendem Download-Button.
Projektbeschreibung
Bildungsaufsteiger*innen haben oftmals verstärkt mit universitären Herausforderungen zu kämpfen. Die erlebten Hürden und Ausgrenzungen werden jedoch oftmals auf subjektiver Ebene verortet und individualisiert, während strukturelle Bedingungen weitgehend unhinterfragt bleiben: Die mit dem Bildungsaufstieg einhergehenden Konflikte und Probleme werden von Studierenden häufig „nicht als sozial bedingt erkannt, sondern von ihnen auf eigenes Versagen zurückgeführt und aus dem Bewusstsein und damit aus der Verbalisierungsmöglichkeit durch die Sprache verdrängt“ (Haeberlin). Obwohl diese Beobachtung mehrere Jahrzehnte zurückliegt, zeigen aktuelle empirische Untersuchungen, dass der Mechanismus des Selbstausschlusses fortwirkt und die Benachteiligung von Studierenden nichtakademischer Herkunft sich in der Regel nicht über Formen offener Ausgrenzung vollzieht, sondern dass der Grund des Exklusionsgefühls vor allem in der eigenen Verunsicherung gegenüber den Anforderungen der universitären Struktur liegt. Diese Diagnose muss gegenwärtig auch im Kontext der Digitalität diskutiert werden. Dabei grenzt sich der kulturtheoretische Begriff der Digitalität von jenem der Digitalisierung insofern ab, indem keine allgemeine Implementierung und Ausweiterung digitaler Infrastrukturen propagiert wird, sondern diverse Wirkmechanismen digitaler Infrastrukturen auf Sozialitäten diskutiert werden. Digitalität wird als jenes übergeordnete Strukturprinzip gefasst, dass die gegenwärtige Gesellschaft grundlegend prägt und aus dem sich eine Reihe von Herausforderungen für Gesellschaft im Allgemeinen und Bildung im Speziellen ableitet. Gemeint ist etwa die Tendenz zur Quantifizierung und Optimierung, zur Normierung und Leistungssteigerung, zur Steigerung von Unsicherheiten bei gleichzeitigem Ausschluss all jener Erfahrungen, die nicht oder nur schwer digital abgebildet werden können. Im Kontext einer Gesellschaft in der Digitalität müssen jedoch auch jene gesellschaftlichen Transformationsprozesse in den Blick geraten, die qua Digitalisierungsdynamiken zu einer digitalen Kluft im sozialen Raum und auch im Hochschulwesen führen.
Das Projekt beabsichtigt
- Studierende nicht-akademischer Herkunft durch Bildungsangebote und Maßnahmen für Ungleichheitsmechanismen im Allgemeinenen und im Speziellen in der Digitalität zu sensibilisieren, zu fördern und zu empowern.
- Studierende akademischer Herkunft für Klassismus(kritik) zu sensibilisieren, indem eigene Privilegien erkannt und reflektiert werden.
- Lehrende und andere Interessierte für Klassismus(kritik) im Hochschulkontext zu sensibilisieren und klassismusreflektierende Haltungen in der Lehre (auch im Hinblick auf Einsatz digitaler Infrastrukturen) zu entwickeln und zu stärken.
- Die Bedeutung der Digitalität für die Reproduktion von Klassismus und sozialer Ungleichheit insbesondere im Hochschulwesen aufzuzeigen.