Die Ringvorlesung „Soziale Ungleichheit, Klasse und Digitalität“ wird vom Arbeitsbereich Pädagogik in der Digitalität und vom Praxislabor im Rahmen des zQSL-Projekts KLADI – Klassismus in der Digitalität begegnen organisiert.
Sie findet im Wintersemester 25/26 jeden Mittwoch von 18:05 bis 19:45 Uhr in S1|13 Raum 266 (Alexanderstr. 6) statt.
Die Veranstaltung wird hybrid durchgeführt: Sie können entweder vor Ort an der TU Darmstadt oder digital via Zoom teilnehmen:
Zoom-Zugang: https://tu-darmstadt.zoom-x.de/j/62839817935?pwd=k5pSXpwDvH2kYWjCobR9AlcKfpPY0l.1
Meeting-ID: 628 3981 7935
Kenncode: 660732
Die Vortragsreihe richtet sich an Studierende, aber auch an Mitarbeitende aller Fachbereiche und Einrichtungen der TU Darmstadt sowie an alle Interessierten außerhalb der TU Darmstadt und bietet spannende Einblicke in aktuelle Diskurse rund um soziale Ungleichheit und digitale Entwicklungen.
Soziale Ungleichheit, Klasse & Digitalität
Wie beeinflusst die voranschreitende Digitalisierung bestehende soziale Ungleichheiten? Welche Rolle spielen soziale Ungleichheiten in der Digitalität? Können digitale Technologien „gerechter“ gestaltet werden?
Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der Ringvorlesung. Internationale Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis werden die Wechselwirkungen zwischen digitaler Infrastruktur und gesellschaftlichen Ungleichheitsstrukturen beleuchten – damit versucht die Ringvorlesungen zwei Themenfelder zusammenzuführen, die bisher noch nicht systematisch verknüpft wurden.
Wir laden Sie herzlich ein, mit uns gemeinsam über soziale Ungleichheit und die Herausforderungen in der Digitalität nachzudenken und zu diskutieren.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Das KLADI-Team:
Nina Grünberger
Susanne Pawlewicz
Kathrin Schulz
Kassandra Wuttig
Olga Zitzelsberger
Zeit und Ort: Mittwochs von 18:05 Uhr – 19:45 Uhr in S1|13 Raum 266 in der Alexanderstr. 6 in 64283 Darmstadt (oder via Zoom).
Der Auftakt der Ringvorlesung ist am Mittwoch, den 15.10.2025, die Abschlussveranstaltung am Mittwoch, den 11.02.2026.
Zoom-Zugang:
Bitte melden Sie sich mit Klarnamen an.
https://tu-darmstadt.zoom-x.de/j/62839817935?pwd=k5pSXpwDvH2kYWjCobR9AlcKfpPY0l.1
Meeting-ID: 628 3981 7935
Kenncode: 660732
Moodle-Kurs: https://moodle.tu-darmstadt.de/course/view.php?id=43503
Im Anschluss an die Ringvorlesung besteht die Möglichkeit, sich in informeller Runde in einem nahegelegenen Lokal auszutauschen. Die Kosten für Speisen und Getränke sind selbst zu tragen.
Für Studierende des M.A. Bildungswissenschaften: Modul: 03-01-5005LV-Nummer: 03-01-5109-vl
Für Studierende aller Fachbereiche der TU Darmstadt und Wahlpflichtbereich: Modul-Nummer im Gesamtkatalog: 03-01-9050
Möglichkeiten zum Austausch und zur Diskussion sowie Lektüre finden Studierende der TU Darmstadt im zugehörigen Moodle-Kurs in den Task Cards. Der Moodle-Kurs ist ebenfalls zugänglich für Externe (nur lesen, keine Schreibrechte), wenn Sie sich über einen Gast-Zugang anmelden. Hier erfahren Sie, wie das ohne TU-ID geht:
https://www.e-learning.tu-darmstadt.de/werkzeuge/moodle/moodle_faq_lehrende/artikel_details_10432.de.jsp
Wenn Sie Unterstützungsmöglichkeiten brauchen, um an der Ringvorlesung partizipieren zu können, lassen Sie es uns gern via Kontakt-Button (oben) wissen.
Wir freuen uns auf Sie!
Ein Großteil der Vorträge wird aufgezeichnet und im Anschluss auf der Online-Plattform OpenLearnWare [ https://openlearnware.tu-darmstadt.de/] der TU Darmstadt zur Verfügung gestellt. Ein Link zur Veranstaltung wird folgen.
Übersicht der Referent*innen, Abstracts und Kurzbios
15.10.25 (Präsenz)

Einführung
Nina Grünberger & Susanne Pawlewicz
In welchem Verhältnis stehen Soziale Ungleichheit, Klasse und Digitalität? Welche ungleichheitsrelevanten Transformationen vollziehen sich im Zeitalter der Digitalität? In der ersten Sitzung werden die Organisator*innen der Ringvorlesung, Nina Grünberger und Susanne Pawlewicz, in das Thema der Vorlesung einführen, den Semesterplan vorstellen und organisatorische und prüfungsrelevante Fragen klären.
22.10.25 (Präsenz)

Sozialstruktur und Digitalkultur: Zum Zusammenhang von sozialer Ungleichheit und Digitalität im Hochschulkontext
Silke Schreiber-Barsch (Universität Duisburg-Essen) Bildrechte: Silke Schreiber-Barsch
Soziale Herkunft beeinflusst Entscheidungen zur Aufnahme eines hochschulischen Bildungsweges. Wenngleich Hochschulen als Orte für Chancengleichheit und individueller Förderung gelten und Zugangshürden für Menschen aus nichtakademischen Milieus gesenkt wurden, bleiben soziale Selektionsmechanismen wirkmächtig. Diese rekurrieren in Anlehnung an Bourdieus Habitus-Feld-Konzept auf einen „akademischen Habitus“, der an spezifische Arten des Sprechens, Schreibens und Auftretens gekoppelt ist und an der Hochschule vorausgesetzt wird. Für sog. First Ge-neration Academics können die Bewältigung solcher Anforderungen mit hohen Anstrengungen verbunden sein bzw. Studienzweifel oder Abbrüche auslösen. Die zunehmende Bedeutung digitaler Bildung kann Chancengleichheit an Hochschulen erhöhen – allerdings gleichfalls im Zugang zu und dem Umgang mit digitalen Medien nochmals verschärfen. Hochschulen sind vor diesem Hintergrund als Aufgabe ihres Diversity-Managements dazu angehalten, eine Sensibilität für die Heterogenität der Studierenden zu fördern und eigene Strukturen kritisch zu reflektieren, wie wir anhand empirischer Forschungsprojekte darlegen möchten.
Silke Schreiber-Barsch ist seit 2021 Professorin für Erwachsenenbildung am Institut für Berufs- und Weiterbildung an der Universität Duisburg-Essen. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen Partizipation und Inklusion/Exklusion am Lebenslangen Lernen, Übergänge und Grundbildung Erwachsener (Schwerpunkt: Numeralität), inklusive Erwachsenenbildung, internationale und vergleichende Erwachsenenbildung sowie Nachhaltigkeit und Global Citizenship Education. Silke Schreiber-Barsch ist seit 2024 Mitglied in dem UDE-Hub zur Förderung von Nachhaltigkeit und Bildung für Nachhaltige Entwicklung und seit 2019 Mitherausgeberin des European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA). Sie studierte Erziehungswissenschaften mit den Schwerpunkten Erwachsenenbildung sowie außerschulische Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen an der Universität Hamburg und promovierte zum Thema „Von Bildungsprogrammatik zu Support neuer Lerninfrastrukturen – rethinking lifelong learning? Forschungsergebnisse zur europäischen Praxis des Lebenslangen Lernens am Beispiel von Learning Communities.“

Sozialstruktur und Digitalkultur: Zum Zusammenhang von sozialer Ungleichheit und Digitalität im Hochschulkontext
Johanna Deuke (Hochschule Bochum) Bildrechte: Privat
Soziale Herkunft beeinflusst Entscheidungen zur Aufnahme eines hochschulischen Bildungsweges. Wenngleich Hochschulen als Orte für Chancengleichheit und individueller Förderung gelten und Zugangshürden für Menschen aus nichtakademischen Milieus gesenkt wurden, bleiben soziale Selektionsmechanismen wirkmächtig. Diese rekurrieren in Anlehnung an Bourdieus Habitus-Feld-Konzept auf einen „akademischen Habitus“, der an spezifische Arten des Sprechens, Schreibens und Auftretens gekoppelt ist und an der Hochschule vorausgesetzt wird. Für sog. First Ge-neration Academics können die Bewältigung solcher Anforderungen mit hohen Anstrengungen verbunden sein bzw. Studienzweifel oder Abbrüche auslösen. Die zunehmende Bedeutung digitaler Bildung kann Chancengleichheit an Hochschulen erhöhen – allerdings gleichfalls im Zugang zu und dem Umgang mit digitalen Medien nochmals verschärfen. Hochschulen sind vor diesem Hintergrund als Aufgabe ihres Diversity-Managements dazu angehalten, eine Sensibilität für die Heterogenität der Studierenden zu fördern und eigene Strukturen kritisch zu reflektieren, wie wir anhand empirischer Forschungsprojekte darlegen möchten.
Johanna Deuke ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt (Schwerpunkt Mediendidatik- und design) an der Hochschule Bochum tätig. Sie studierte Erwachsenenbildung und Weiterbildung mit dem Schwerpunkt Medienbildung an der Universität Duisburg-Essen. Zur zeit promoviert sie an der Universität Duisburg-Essen und beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von digitalen Handlungspraktiken und sozialer Ungleichheit im Hochschulstudium.
29.10.25 (Online) (Ausfall!!! findet nicht statt)

Dimensionen digitaler Ungleichheit - Subjekt, Kontext, Artefakte
Nadia Kutscher (Universität zu Köln) Bildrechte: AZ Fotografie
Dieser Beitrag befasst sich mit dem Zusammenspiel subjektiver (habitueller) Voraussetzungen, struktureller bzw. institutioneller Kontextbedingungen und der Affordanzen digitaler Artefakte in der (Re)Produktion digitaler Ungleichheit. Auf der Basis verschiedener empirischer Studien wird beleuchtet, wie die Hervorbringung ungleicher Bildungs- bzw. sozialer Teilhabe im Kontext von Digitalität in den Blick genommen werden kann. Auf diese Weise wird es möglich, digitale Ungleichheit „zwischen den Zeilen“ zu verstehen und zu rekonstruieren.
Nadia Kutscher ist seit 2017 Professorin für Erziehungshilfe und Soziale Arbeit an der Universität zu Köln. Ihre Arbeitsschwerpunkte umfassen unter anderem Digitalisierung und Digitalität in der Sozialen Arbeit, Digitale Mediennutzung im Kontext von Kindheit, Jugend und Familie, Digitale Ungleichheit, ethische Fragen Sozialer Arbeit sowie Bildung und soziale Ungleichheit. Aktuell laufende Projekte sind das BMBFSFJ-geförderte Projekt „Digitale Kompetenzen in der Kinder- und Jugendhilfe“ (DiKoJu) und die Jugendämterbefragung zur Fachkraftsituation im ASD in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg (FaSiBa). Nadia Kutscher war u.a. Mitglied der Sachverständigenkommission für den 14. Und den 17. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung und des Bundesjugendkuratoriums, sie ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Jugendinstituts (DJI)und seit 2021 Vorsitzende der Jury für den Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreis – Hermine Albers-Preis der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. Sie studierte Sozialarbeit/Sozialpädagogik an der Katholischen Stiftungsfachhochschule München und Erziehungswissenschaft an der Universität Bielefeld, wo sie auch promovierte.
05.11.25 (Präsenz)

Lektüresitzung
Nina Grünberger & Susanne Pawlewicz
In dieser Sitzung erfolgt eine Lektüresitzung. Gemeinsam mit Nina Grünberger, Susanne Pawlewicz und den Studierenden werden Inhalte in Form von Literatur vertieft.
12.11.25 (Online)

Soziale Arbeit, Digitalität und Ungleichheit
Isabel Zorn (TH Köln) Bildrechte: TH Köln
Soziale Ungleichheit wird alltäglich (re-)produziert und ist eines der drängendsten Probleme moderner Gesellschaften. Eine wachsende Zahl alltäglicher Prozesse und Praktiken findet digital statt. Mit diesem Digitalisierungsprozess wird oftmals die Hoffnung verbunden, zuvor bestehende Barrieren abzubauen und damit die Chancen auf Teilhabe zu egalisieren. Künstliche Intelligenz verspricht, einfach Informationen und ihre Auswertung verfügbar zu machen. Zugleich gibt es aber Hinweise darauf, dass durch digitale Technologien neue Ungleichheiten entstehen oder alte reproduziert werden können. Zudem wird aufgezeigt, wo und wie bislang mit welchen Zielen Digitalisierung in Praktiken und in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit stattfindet und welche Konsequenzen dies für die Aufgabenerfüllung, die Interaktionen, die Expertise in der Sozialen Arbeit hat.
Im Vortrag wird aufgezeigt, wie diverse Formen sozialer Ungleichheit in digitalen Räumen abgebaut, hervorgebracht oder reproduziert werden. Wie und wodurch übersetzen sich zugrundeliegende Prozesse und Praktiken von Ungleichheit in Digitalität? Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für die Soziale Arbeit?
Isabel Zorn ist Professorin für Digitalität und Soziale Transformation am Institut für Medienforschung und Medienpädagogik an der TH Köln. Sie forscht zu Digitalität in der Sozialen Arbeit, Medienbildung und Inklusion, Datenschutz und Privatsphäre im Digitalen, und zu gesellschaftlicher Teilhabe. 2025 erhielt sie den Transferpreis der TH Köln für die Projekte „BOTschafft Inklusion“, welches Eingliederung und Teilhabe von pflegenden Angehörigen in den Arbeitsmarkt per KI-Chatbot unterstützt, und „Pflegeschätze“, welches sich für die Sichtbarmachung der Alltagsexpertise von pflegenden Angehörigen einsetzt. Isabel Zorn studierte Erziehungswissenschaft, Psychologie und interkulturelle Wirtschaftskommunikation an der Universität Jena. Sie lehrt in den Bereichen Medienpädagogik und Digitale Medien in der Sozialen Arbeit.
19.11.25 (Online)

Digitaler Kapitalismus goes fascist: Gegenstandsskizzen und bildungsbezogene Bearbeitungsweisen
Valentin Dander (Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur) Bildrechte: HCHP, Nutzungsrecht Dr. Valentin Dander
Die zweite Trump-Administration in den USA steht sinnbildlich für neue Verbindungslinien zwischen Kapital, Digitaltechnologien und einen faschistoiden Autoritarismus. Zeigten sich Protagonist:innen des Silicon Valley bislang zumindest ambivalent gegenüber der neuen Rechten und skeptisch gegenüber staatlichen Institutionen, besteht das neue Projekt darin, den Staat zu übernehmen und im Stil eines Unternehmens disruptiv umzugestalten. Von diesen Entwicklungen bleiben weder EU oder Mitteleuropa noch der Bildungsbereich unberührt – bis hin zu vergleichbaren gesellschaftspolitischen Tendenzen. Welche Rolle spielen in diesem Machtspiel von Tech- und anderen Milliardären „Schlägertrupps von sozial Deklassierten“ (Deppe 2018:249 zu Karl Marx‘ Bonapartismusanalyse), gerade auch in digitalen Räumen? Welche weiteren Deklassierungsweisen bleiben dabei unberücksichtigt? Und schließlich die zentrale Frage: Welche Relevanz kommt zur pädagogischen Bearbeitung dieser Problemzonen den verschwisterten Bereichen der politischen und der Medienbildung zu (Dander/Grünberger/Niesyto/Pohlmann et al. 2024, Dander 2024)?
Valentin Dander leitet für die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) das Projekt „toneshift – Netzwerk gegen Hass im Netz und Desinformation“. Er studierte (Medien-)Pädagogik und Germanistik in Innsbruck, Heidelberg und Bielefeld und promovierte zum Thema „Zurück in die Zukunft der Medienpädagogik. „Subjekt“, „Bildung“ und „Medien*Kritik“ im Lichte | im Schatten digitaler Daten“ an der Universität zu Köln. Bis 2024 war er Professor an der Fachhochschule Clara Hoffbauer Potsdam. In seiner Arbeit beschäftigt er sich mit Themen wie Bildung und digitaler Kapitalismus, Datafizierung sowie dem Verhältnis von Medialität und Politizität bzw. von politischer Bildung und Medienbildung.
26.11.25 (Online)

Data Feminism in Action
Catherine D'Ignazio (MIT – Massachusetts Institute of Technology) Bildrechte: Gretchen Ertl
As data and AI are increasingly mobilized in the service of global corporations, governments, and elite institutions, their unequal conditions of production, their inequitable impacts, and their asymmetrical silences become increasingly more apparent. It is precisely this power that makes it worth asking: „Data science by whom? AI for whom? In whose interest? Informed by whose values?“ And most importantly, „How do we begin to imagine alternatives for data’s collection, analysis, and communication?“ These are some of the questions that emerge from what Lauren Klein and I call Data Feminism (MIT Press 2020). In this talk, I will present the data feminism principles, along with recent work from my most recent book, Counting Feminicide (MIT Press 2024). Drawing from a large-scale participatory action research project, I will describe how data activists enact alternative epistemological approaches to data science that center care, memory and justice. These informatic practices constitute a form of „epistemic disobedience“ to the reigning logics of AI and data science. This talk, and the book that it draws from, make the case that grassroots data activists, predominantly from Latin America, are at the forefront of a data ethics that rigorously and consistently takes power and people into account.
Catherine D’Ignazio is an Associate Professor of Urban Science and Planning in the Department of Urban Studies and Planning at MIT (USA). She is also Director of the Data + Feminism Lab which uses data and computational methods to work towards gender and racial justice. D’Ignazio is a scholar, artist/designer and hacker mama who focuses on feminist technology, data literacy and civic engagement. Her 2020 book from MIT Press, Data Feminism, co-authored with Lauren Klein, charts a course for more ethical and empowering data science practices. Since 2019, she has co-organized Data Against Feminicide,a participatory action-research-design project, with Isadora Cruxên, Silvana Fumega and Helena Suárez Val, which includes co-designed AI tools for human rights data activists. Her 2024 book, Counting Feminicide: Data Feminism in Action (MIT Press) is an extended case study about grassroots data activism to end gender-related violence. D'Ignazio's research at the intersection of technology, design & social justice has been published in the Big Data & Society, the Journal of Community Informatics, and the proceedings of ACM SIGCHI and ACM FAccT. Her art and design projects have won awards from the Tanne Foundation, Turbulence.org and the Knight Foundation and exhibited at the Venice Biennial and the ICA Boston.
03.12.25 (Präsenz)

Zwischen Können und Kopieren – KI und die unsichtbaren Regeln akademischen Schreibens
Katarina Froebus (PPH Augustinum) Bildrechte: Foto Mur Graz
Wissenschaftliches Schreiben gilt als zentrale akademische Praxis – zugleich stellt es gerade Studierende nicht-akademischer Herkunft vor Hürden. Der Einzug von KI-Tools wie ChatGPT verspricht zunächst Erleichterung durch die Verfügbarkeit unterschiedlichster Hilfestellungen. Doch wie verändert sich die Herausforderung wissenschaftlichen Schreibens unter Bedingungen digitaler Schreibtools? Und für wen? Der Vortrag fragt nach den verschobenen Anforderungen im Umgang mit KI – zwischen neuen Möglichkeitsräumen und alten Ausschlüssen. Im Fokus stehen dabei Fragen der (Un-)Sichtbarkeit impliziter Regeln, der Angst vor Plagiat und der Bedeutung von Habitusreflexivität in einer Kultur der Digitalität.
Dr.in Katarina Froebus ist Hochschullehrende an der Privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum, sie lehrt dort in den Bildungswissenschaftlichen Grundlagen für das Lehramt Primarstufe und forscht im Projekt „GoProf: PädaGOgische PROFessionalisierung forschend begleiten“.Das Studium der Pädagogik, Psychologie und Anglistik absolvierte sie an der TU Darmstadt. Ihre Dissertation „Das Un-tote in der Pädagogik. Rekonstruktive Studien zur Subjektkritik“ schloss sie an der Universität Graz ab.
Im Bereich der Lehre lag der Schwerpunkt von Katarina Froebus bisher besonders auf professionalisierungs¬theoretischen Fragestellungen im Licht gesellschaftskritischer und differenztheoretischer Zugänge, Biografie- und Erinnerungsarbeit sowie philosophischer, partizipativer und biografischer Forschung. Geforscht und publiziert hat sie zu Subjektivierungstheorie und Posthumanismus, Kritischer Bildungstheorie und sozialer Ungleichheit, Autosoziobiographie und machtkritischer Professionalisierung sowie Machtverschiebungen in der Online-Lehre.
10.12.25 (Präsenz)

Die Illusion der Chancengleichheit – reloaded. Medialer und/oder digitaler Habitus als Erklärungsmuster für die Fortschreibung sozialer Ungleichheit
Sven Kommer (RWTH Aachen) Bildrechte: Bildungskonzil Heldenberg
Der Anfang der 2000er Jahre entwickelte Ansatz des ‚medialen Habitus‘ diente zunächst einmal zur Bearbeitung der Frage, „warum die (neuen) Medien nicht in die Schule kommen“. Aktuell sind die ‚neuen Medien‘ Digitalisierung und KI – und immer häufiger sind sie auch in der Schule angekommen. Studien wie ICILS zeigen aber eindrücklich, dass die gerade auch mit diesen Medien verbundene Idee einer ‚Chancengleichheit‘ keinesfalls gegeben ist.
Vor dem Hintergrund von Bourdieus Habitus-Konzept (das selbstverständlich zu modernisieren ist) erscheint dies allerdings kaum verwunderlich – sind doch die Ausgangsvoraussetzungen bereits beim Eintritt in das formale Bildungssystem äußerst heterogen. So kommt Schule und Hochschule die (auch gesellschaftspolitisch) zentrale Aufgabe zu, hier habitus-sensibel zu reagieren und keineswegs unreflektiert den pauschalen Versprechungen der KI-Industrie zu folgen.
Sven Kommer ist seit 2013 Professor „Didaktik und Digitale Bildung“ an der RWTH Aachen. Er studierte Lehramt (Realschule mit den Fächern Musik, Deutsch und Mathematik) an der PH Ludwigsburg und absolvierte seine Promotion („Kinder und Werbung. Qualitative Studie zum Werbeangebot und zum Werbeverhalten von Kindern“) bei Dieter Baacke an der Universität Bielefeld.
Die 2008 an der PH Freiburg eingereichte Habilitationsschrift trug den Titel „Kompetenter Medienumgang? Eine qualitative Untersuchung zum medialen Habitus und zur Medienkompetenz von SchülerInnen und Lehramtsstudierenden“. Außerdem war er auch Hochschuldozent für Medienpädagogik an der PH Freiburg. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Medienbildung und Medienkompetenz, Mediendidaktik, Medialer Habitus, Medien und soziale Ungleichheit sowie mediengestützte Lernforschung.
17.12.25 (Präsenz)
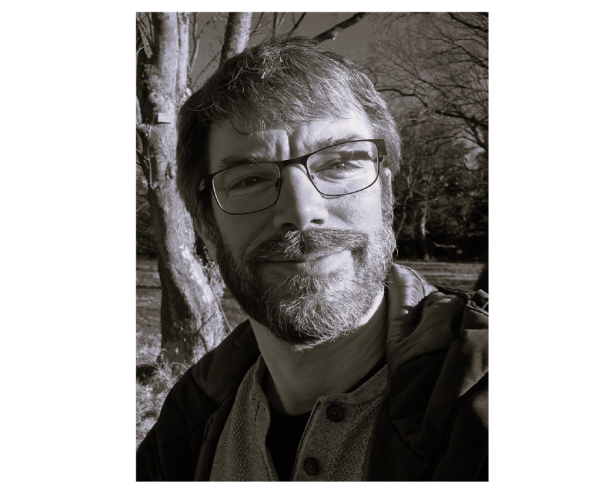
Ungleichheit – Emanzipation – Ressentiment. Demokratiebildung in der politischen Kultur der Digitalität
Carsten Bünger (Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd) Bildrechte: Privat
Von Felix Stalder stammt der Vorschlag, die Kultur der Digitalität von ihrer Geschichte her zu verstehen. Zu ihren zentralen Kennzeichen zählen demnach nicht technologische Erfindungen, sondern eine durch die ‚westlichen‘ Demokratien im 20. Jahrhundert verlaufende „Ausweitung der sozialen Basis der Kultur“: Von zunächst marginalisierten oder ausgeschlossenen Positionen her wird zunehmend der Anspruch auf Mitsprache erhoben, was sich in öffentlichen und medialen Aneignungen niederschlägt. Diese Entwicklungen, die als Demokratisierungs- und Emanzipationsprozesse verstanden werden können, verbinden sich mit neoliberalen Selbstverwirklichungserwartungen – und Enttäuschungserfahrungen.
Der Vortrag fokussiert Ambivalenzen in der politischen Kultur der Digitalität und geht auf populistische wie digitalkapitalistische Indienstnahmen des Ressentiments ein. Zudem wird die Frage nach einer Demokratiebildung aufgeworfen, die sich weder in Medien-, noch in Demokratiekompetenzen erschöpfen kann.
Carsten Bünger ist Professor für Allgemeine Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Bildung und Gesellschaft an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Das Magisterstudium der Pädagogik sowie seine Promotion mit dem Titel „Die offene Frage der Mündigkeit. Studien zur Politizität der Bildung“ schloss er am Fachbereich Humanwissenschaften der TU Darmstadt ab. Seine Habilitation erfolgte am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt a.M. Seine Forschungen im Bereich der Allgemeinen Pädagogik und Bildungsphilosophie führten ihn darüber hinaus u.a. an die Universität Koblenz-Landau, die Universität Potsdam, die Universität Wuppertal und die TU Dortmund. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Transformationen der politischen Kultur, Bildungsbedingungen der Demokratie, bildungstheoretische Perspektiven auf Digitalität, ethische Problemstellungen des Pädagogischen, sowie Ambivalenzen pädagogischer Autorität und Macht.
14.01.26 (Präsenz)

Zum normativen Horizont des Bildungsgegenstands „Digitalität“
Inken Heldt (Universität Passau) Bildrechte: Uni Passau
Entlang empirisch erhobener Denkweisen angehender Politiklehrkräfte werden virulente Annahmen über `das Politische´ von Digitalität und über den normativen Horizont des Bildungsgegenstandes greifbar gemacht – und diskutiert, inwiefern die Wechselwirkungen zwischen digitaler Infrastruktur und gesellschaftlichen Ungleichheitsstrukturen bisher keine Rolle in der politischen Bildung und einschlägiger Fachdidaktiken spielen.
Prof. Dr. Inken Heldt ist seit 2024 Professorin für das Politische System der Bundesrepublik Deutschland und Politische Bildung an der Universität Passau. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen Menschenrechte, Digitalität, Nachhaltigkeit und Subjektive Theorien. Sie war 2019/2020 zwei Semester als Gastprofessorin für Digital Citizenship Education an der Universität Wien tätig und hat 2021/2022 für zwei Semester die Professur für Fachdidaktik Gemeinschaftskunde an der Universität Leipzig vertreten. Inken Heldt ist Leiterin zahlreicher drittmittelgeförderter Projekte und Autorin von Beiträgen zu Fragestellungen der Politischen Bildung und zur gesellschaftswissenschaftlichen Fachdidaktik.Sie ist assoziierte externe Direktorin des Instituts für Didaktik der Demokratie an der Leibniz Universität Hannover, berufenes Mitglied im Facharbeitskreis Politische Bildung zur Erneuerung des »Orientierungsrahmens Globale Bildung« (Kultusministerkonferenz), berufenes Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes, assoziiertes Mitglied des Leibniz Forschungszentrum »Inclusive Citizenship« (CINC) und als Gutachterin für verschiedene (inter-)nationale Zeitschriften, Stiftungen und Fachgesellschaften tätig.
21.01.26 (Präsenz)

Insufficient Funds: Ein Expertengespräch zu sozialer Ungleichheit und Klasse in digitalen Spielen
Christian Huberts (freiberuflicher Kulturwissenschaftler)«, »(u.a. Zeit Online, Deutschlandfunk Kultur) Bildrechte: Mina Link
Digitale Spiele spiegeln gesellschaftliche Strukturen wider und bieten Räume für deren Aushandlung. Erstmals populär geworden in den 80ern und 90ern des vergangenen Jahrhunderts, haben sich in ihnen früh die Leistungs- und Wettbewerbsideale des Neoliberalismus manifestiert. Erst seit wenigen Jahren beginnen sie, sich mit diesen ideologischen Prägungen kritisch auseinanderzusetzen. Ein Prozess, der sich ebenso auf Ebene der Spielenden und Spielentwickler*innen abspielt. Im Expertengespräch diskutieren Christian Huberts (Medien- und Kulturwissenschaftler) und Eric Jannot (Professor für Game Design an der HAW Hamburg), wie Klassenverhältnisse in digitalen Spielen dargestellt, thematisiert oder übersehen werden. Im Fokus stehen dabei Fragen nach Repräsentation, Zugang und Nutzung: Wer kann sich welche Spiele leisten? Wie werden Klassenidentitäten im Spiel sichtbar gemacht? Und wie tragen Spielmechaniken oder Narrative zur Reproduktion oder Kritik sozialer Ungleichheit bei?
Christian Huberts, Jahrgang 1982, studierte »Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis« an der Universität Hildesheim und arbeitet seit 2011 als kultur- und medienwissenschaftlicher Publizist mit Sitz in Berlin. Sein inhaltlicher Fokus ist die digitale Spielkultur in allen Facetten. Er tritt regelmäßig als Experte für digitale Spiele bei Kulturveranstaltungen sowie im Rundfunk und Fernsehen auf. Zuletzt hat er unter anderem den Game-Studies-Sammelband »Zwischen|Welten: Atmosphären im Computerspiel« im vwh-Verlag herausgegeben, das »Handbuch Gameskultur« des Deutschen Kulturrats und des Branchenverbands game redaktionell betreut sowie das Berliner Studio waza! Games als Associate Producer bei der Entwicklung der politischen Bildungs-App Konterbunt unterstützt. Für die Stiftung Digitale Spielekultur arbeitete er von März 2020 bis August 2024 unter anderem als Projektmanager für die Initiative »Erinnern mit Games« und als Projektleiter von »Let’s Remember!«. Seit Mai 2025 leitet er dort das Projekt »Schule mit Games gestalten NRW – Demokratie und Teilhabe spielend fördern«. Daneben schreibt er für wissenschaftliche Publikationen, Kulturmagazine sowie Online-Zeitungen diverse Artikel über die Partizipation an virtuellen Welten und die Kultur von Computerspielen.

Insufficient Funds: Ein Expertengespräch zu sozialer Ungleichheit und Klasse in digitalen Spielen
Eric Jannot (HAW Hamburg) Bildrechte: Privat
Digitale Spiele spiegeln gesellschaftliche Strukturen wider und bieten Räume für deren Aushandlung. Erstmals populär geworden in den 80ern und 90ern des vergangenen Jahrhunderts, haben sich in ihnen früh die Leistungs- und Wettbewerbsideale des Neoliberalismus manifestiert. Erst seit wenigen Jahren beginnen sie, sich mit diesen ideologischen Prägungen kritisch auseinanderzusetzen. Ein Prozess, der sich ebenso auf Ebene der Spielenden und Spielentwickler*innen abspielt. Im Expertengespräch diskutieren Christian Huberts (Medien- und Kulturwissenschaftler) und Eric Jannot (Professor für Game Design an der HAW Hamburg), wie Klassenverhältnisse in digitalen Spielen dargestellt, thematisiert oder übersehen werden. Im Fokus stehen dabei Fragen nach Repräsentation, Zugang und Nutzung: Wer kann sich welche Spiele leisten? Wie werden Klassenidentitäten im Spiel sichtbar gemacht? Und wie tragen Spielmechaniken oder Narrative zur Reproduktion oder Kritik sozialer Ungleichheit bei?
Eric Jannot ist Professor für Games an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, Studiendekan für Game Design und Management an der Hochschule Fresenius, sowie seit 2012 Geschäftsführer bei waza! games, für das er journalistische Computerspiele sowie Serious Games konzipiert und produziert. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen den Einsatz von Spielen in der politischen Bildung, User Centered Design und Game Based Learning. Er studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der FU Berlin, sowie Game Studies an der Donau Universität Krems. Nach seinem Studium der Publizistik hat Eric Jannot mehr als zehn Jahre in der Spielebranche gearbeitet, davon zwei im Bereich Public Affairs und drei als Freelancer sowie als Senior Game Designer bei The Games Company. Von 2010 bis 2012 war er Head of Design bei den Noumena Studios und verantwortete die kreative Leitung des mit dem deutschen Entwicklerpreis ausgezeichneten Spiels „Demonicon“.
28.01.26

Wissensdiversität und Diversity Literacy - Kritische Reflexionen zu einigen Ambivalenzen in Bildungskulturen der Digitalität
Theo Hug (Universität Innsbruck) Bildrechte: Lichtraum
Die Ausdrücke ‚Diversität‘ und ‚Literalität‘ werden in unterschiedlichen Diskurszusammenhängen in vielgestaltiger Weise verwendet. Abgesehen von unterscheidbaren Grundbedeutungen, die dabei eine Rolle spielen, beziehen sich diese Verwendungsweisen auf unterschiedliche Phänomenbereiche. Im Fall von ‚Diversität‘ sind die Anwendungsbezüge oft auf soziale, körperliche, kulturelle, geschlechterbezogene, linguistische, ökonomische oder biologische Dimensionen fokussiert – im Fall von Literalität reicht das Spektrum von AI Literacy bis Zoological Literacy. Neuerdings werden in unterschiedlichen Diskurszusammenhängen auch Fragen der Wissensdiversität und der Diversity Literacy diskutiert. Ausgehend von einer Erläuterung grundlegender Konzepte, die mit diesen beiden Ausdrücken verbunden sind, werden im Beitrag sowohl thematische Zusammenhänge an den Nahtstellen von Wissensdiversität und Diversity Literacy als auch entsprechende Ambivalenzen in Bildungskulturen der Digitalität kritisch reflektiert.
Theo Hug ist Professor für Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Medienpädagogik und Kommunikationskultur am Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation der Universität Innsbruck. Er forscht und lehrt in den Bereichen Medienpädagogik, Medienbildung und Digitale Grundbildung, Bildungs-, Medien- und Wissenstheorie, mobiles Lernen und Mikrolernen sowie Methodologie und Wissenschaftsphilosophie. Er hatte diverse Gastprofessuren und Lehraufträge in Wien, Bozen, Graz, Krems, Schloss Hofen (Vorarlberg), Salzburg und Brisbane (AU), 2005 war er Visiting scholar im Comparative Media Studies (CMS) program am Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) in Cambridge, MA (USA). Von 2004 bis 2024 war er Sprecher des interfakultären Forums Innsbruck Media Studies an der Universität Innsbruck, von 2003 bis 2006 leitete er das ARC-Research Studio eLearning Environments. Seit 2011 ist er gemeinsam mit Josef Mitterer Nachlassverwalter des Ernst von Glasersfeld Archivs (https://www.evg-archive.net/). Von 2020 bis 2024 war er Leiter des Instituts für Medien, Gesellschaft und Kommunikation, seit 2015 ist er u. a. Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste.
04.02.26 (Präsenz)
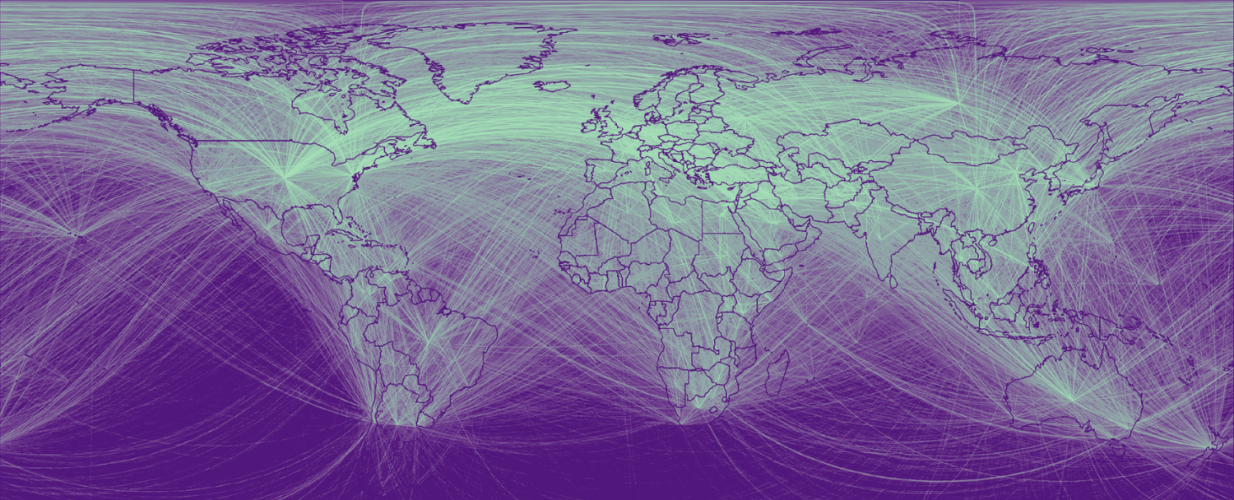
Podiumsdikussion: Soziale Ungleichheit, Klasse und Digitalität
Peter Euler, Ekaterina Jussupow, Benedikt Pielenz, Pia Hornickel, Kassandra Menzel-Wuttig (TU Darmstadt)
Bei der Podiumsdiskussion werden die TU Darmstadt-Angehörigen Prof. Dr. Peter Euler (Em., Lehrstuhl Allgemeine Pädagogik und Pädagogik der Natur-und Umweltwissenschaften), Pia Hornickel (M.Sc. Informatik und Pädagogik-Studentin), Prof.in. Dr.in Ekaterina Jussupow (Wirtschaftsinformatik), Benedikt Pielenz (M.A. Bildungswissenschaften, arbeitet u.a. zu AI Literacy in Studium und Lehre) und Kassandra Menzel-Wuttig (B.A. Pädagogik, Mitarbeiterin im Projekt „Klassismus in der Digitalität begegnen“) über die Verschränkung von Sozialer Ungleichheit, Klasse und Digitalität in ein gemeinsames Gespräch und u.a. über die Bedeutung dieses Themenkomplexes für die TU Darmstadt sprechen.
11.02.26 (Präsenz)

Habitus und Kapital in der digitalisierten Klassengesellschaft
Jutta Hergenhan (Universität Gießen) Bildrechte: Center for Diversity, Media and Law (DiML)
Die Digitalisierung der sozialen Welt war von einem großen Freiheits- und Gleichheitsversprechen begleitet: Der Zugang zu Informationen und Wissen sowie Kommunikations- und Teilhabemöglichkeiten würden fortan nicht mehr von geographischen, materiellen oder körperlichen Faktoren abhängig sein. Nur ein Internetanschluss schien notwendig. Seitdem haben die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung soziale Interaktion tiefgreifend verändert, soziale Ungleichheiten aber keineswegs aufgehoben. Vielmehr werden auch tiefgreifende politische Veränderungen durch die Funktionsweisen digitaler Plattformen maßgeblich bedingt. Im Vortrag wird der Frage nachgegangen, wie sich soziale Ungleichheit und Gewaltverhältnisse in digitalen Lebenswelten re-strukturieren und wie sich dieser Wandel mit den Begriffen Pierre Bourdieus (Habitus, Kapital, symbolische Gewalt) theoretisch fassen lässt. Wie artikuliert sich beispielsweise „sexuelles Kapital“ oder „emotionales Kapital“ (Illouz) im digitalen Raum? Was ist „digitaler Habitus“ und wie ermöglicht Digitalisierung „smarte Gewalt“?
Dr.in Jutta Hergenhan ist seit 2017 wissenschaftliche Koordinatorin am Center for Diversity, Media, and Law (DiML) der Justus-Liebig-Universität Gießen. Seit dem Jahr 2016 ist Dr. Hergenhan als Mitglied des ZMI-Direktoriums und der Sektion 1 „Macht – Medium – Gesellschaft“ an zahlreichen wissenschaftlichen Aktivitäten des Zentrums beteiligt. Im Vorgängerprojekt „ Zentrums für Medien und Interaktivität (ZMI) der Justus-Liebig-Universität Gießen war sie ebenfalls als wissenschaftliche Koordinatorin tätig und Sprecherin der ZMI-Sektion “Medien und Gender". Zuvor war sie Geschäftsführerin der Arbeitsstelle Gender Studies, wissenschaftliche Mitarbeitende und Frauenbeauftragte des Instituts für Politikwissenschaft sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin des Projekts „Einstellungen-Medien-Engagement-Lehren“ (EMEL). Hier nahm sie an der Untersuchung von politischen Einstellungen, gesellschaftspolitischem Engagement und Mediennutzung von Gießener Lehramtsstudierenden teil. Jutta Hergenhan studierte Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin, dem Institut d’Études Politiques in Paris und der Universität Mannheim. An der Freien Universität Berlin promovierte Jutta Hergenhan zum Thema „Geschlecht – Politik – Sprache. Zur Bedeutung von Sprache für den Ausschluss von Frauen aus der Politik: der Fall Frankreich“. Forschungsschwerpunkte von Jutta Hergenhan sind Sprache/n in ihrer politischen Wirkung und Bedeutung, Geschlechtergeschichte und -politiken Frankreichs sowie Demokratie- und Geschlechterfragen in der Politischen Bildung.

Habitus und Kapital in der digitalisierten Klassengesellschaft
Henning Tauche (Universität Gießen) Bildrechte: Privat
Die Digitalisierung der sozialen Welt war von einem großen Freiheits- und Gleichheitsversprechen begleitet: Der Zugang zu Informationen und Wissen sowie Kommunikations- und Teilhabemöglichkeiten würden fortan nicht mehr von geographischen, materiellen oder körperlichen Faktoren abhängig sein. Nur ein Internetanschluss schien notwendig. Seitdem haben die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung soziale Interaktion tiefgreifend verändert, soziale Ungleichheiten aber keineswegs aufgehoben. Vielmehr werden auch tiefgreifende politische Veränderungen durch die Funktionsweisen digitaler Plattformen maßgeblich bedingt. Im Vortrag wird der Frage nachgegangen, wie sich soziale Ungleichheit und Gewaltverhältnisse in digitalen Lebenswelten re-strukturieren und wie sich dieser Wandel mit den Begriffen Pierre Bourdieus (Habitus, Kapital, symbolische Gewalt) theoretisch fassen lässt. Wie artikuliert sich beispielsweise „sexuelles Kapital“ oder „emotionales Kapital“ (Illouz) im digitalen Raum? Was ist „digitaler Habitus“ und wie ermöglicht Digitalisierung „smarte Gewalt“?
Henning Tauche studierte Recht, Musik und Geschichte an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Zurzeit promoviert er in Geschichtsdidaktik am International Graduate Center for the Study of Culture (GCSC). Seine Forschungsschwerpunkte sind Geschichtsbilder der Rechten als Herausforderung für die historische Bildung, postnationalsozialistischer und postkolonialer Geschichtsunterricht sowie klassismuskritisches historisches Lernen.



